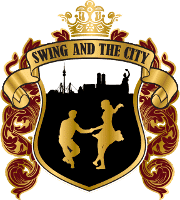In a world on the brink of war. You either march to one tune or dance to another.
Die Geschichte des Swingtanz
Swing entstand in der verrückten Zeit der 20er und 30er Jahre, den „Roaring Twenties“, dem „Jazz age“ und der „Bigband Era“. Das Ende der ersten Weltkrieges war eine Zeit des Aufbruchs und Wandels durch die vielen Heimkehrer aus dem Krieg. Art Deco blühte auf, und das Radio wurde kommerziell. Frauen erhielten das Wahlrecht und wurden selbstbewusster. Der Jazz entstand und wurde populär. Alkohol war Verboten, wurde aber in sogenannten Flüsterkneipen weiterhin konsumiert, was einen gigantischen Schwarzmarkt und Kriminalität schuf – es ist die Zeit von Al Capone. Musik war vorwiegend Live, jedoch gab es schon die ersten Aufnahmen. Erste weiße Gruppen spielen Jazz, eine ursprüngliche „schwarze“ Musik (die aber natürlich bereits viele weiße Einflüsse enthält). Im Cotton Club sind nur Weiße als Gäste erwünscht (die großen Bandleader Duke Ellington und Cab Calloway hingegen waren Schwarze), im Savoy Ballroom aber tanzen Weiße und Schwarze bereits nebeneinander.
Oktober 1929 passierte dann ein radikaler Umbruch: am „Schwarzen Donnerstag“ (in Europa Freitag) begann eine Talfahrt der Börsen, was eine Weltwirtschaftskrise – die „Große Depression“ auslöste. Leute verloren massenweise ihre Arbeitsplätze und Ersparnisse. Es ist die Zeit von Bonnie & Clyde und anderen Kleinkriminellen, Bankräuber werden zu Volkshelden. Im Jazz entsteht der Swing und die großen Big Bands. Die früher sehr „schwarze“ Jazz-Musik bekommt immer mehr „weiße“ Einflüsse, Orchester bestehen immer öfter sowohl aus weißen als auch aus schwarzen Musikern.
Diese Playliste enthält viele der Tanzszenen aus alten Videos aus den 30er und 40er Jahren:
Swing im Dritten Reich
Durch den Kinofilm „Swing Kids“ (1993) rückte die Geschichte des Swing im Nazi-Deutschland stärker in das öffentliche Bewusstsein. Die Meinungen über den Film sind kontrovers: die einen würden sich vermutlich heldenhaftere Charaktere wünschen (sie üben doch eher einen passiven Widerstand aus, und scheitern), andere finden den Film aber gerade deswegen gut, weil er nicht zu sehr auf der „Nazis sind böse“-Welle mitschwimmt, sondern versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen: wie die Nazi-Maschinerie Menschen korrumpiert und mitreißt und so Freundschaften zerstört.
Nicht alle Geschichten sind wahr: Die beliebten „Swing tanzen verboten“-Schilder sind erst in den 70er Jahren „erfunden“ worden. Jedoch galt das von den Nazis erlassene allgemeine Tanzverbot nach Kriegsbeginn natürlich auch für Swing.
Ein allgemeines Swing-Musik-Verbot hingegen gab es (wohl) nicht, jedoch wurden jüdische und schwarze Musiker verboten und diskriminiert. So wurde beispielsweise den „Comedian Harmonists“ das Auftreten in Deutschland verboten, woraufhin diese zunächst im Ausland auftraten und sich letztlich aufspalteten. Und nicht zuletzt waren viele Swing-Anhänger natürlich gegen das Nazi-Regime eingestellt, und wurden dementsprechend verfolgt, wie dieses Dokument des Institut für Zeitgeschichte zeigt.
[…]
Nunmehr muß ich ergänzend mitteilen, daß […] die hot- und swing-Demonstrationen jugendlicher anglophiler Kreise in Hamburg inzwischen staatsfeindliche und reaktionär zersetzende Formen angenommen haben.
[…] staatsfeindliche Einstellung dieser Kreise festgestellt […]
[…] die gesund empfindende Bevölkerung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikalischen Exzesse terrorisieren.
[…] Es erscheint dringend notwendig, die Anführer dieser Kreise, die dem SD und der Gestapo bekannt sind, auszuheben und das bisher sichergestellte Material unerwünschter Schallplatten zu beschlagnahmen, um eine weitere Verbreitung der Swing- und Hot-Seuche in Hamburg und über Hamburg hinaus zu verhindern und ihren schädigenden Einfluß auf andere Jugendliche zu unterbinden.
Ich bitte deshalb den Herrn Minister, einer Sofort-Aktion zuzustimmen, die sich, um eine Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden, gegen die Anführer dieser Kreise richtet und in der Lage sein wird, normale Verhältnisse wiederherzustellen.
[…]
Im Dezember 2007 gab es hierzu im Cord Club (initiiert durch Catrin Kost) eine „Swing Tanzen Verboten“-Veranstaltung mit einem Zeitzeugen, der ein Münchner „Swing Kid“ war und aus seinem Leben erzählte – von passiven Protest als Kind bis zu einer Verurteilung zum Tode (die glücklicherweise nicht vollstreckt wurde).
Weitere Informationen
Wer sich mehr mit der Geschichte des Swing in Deutschland beschäftigen möchte, dem legen wir ganz besonders das Buch „Swingtime in Deutschland“ unseres guten Freundes und Swing-Experten Stephan Wuthe aus Berlin ans Herz!
Für die schnelle Lektüre hier noch einige Links zu Wikipedia: